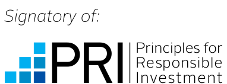In den letzten Monaten hat der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen erheblich an Kaufkraft verloren. Grund dafür ist vor allem die undurchsichtige Zollpolitik von US-Präsident Trump, die das Vertrauen in die USA stark beeinträchtigt hat. Vertrauen und Berechenbarkeit sind derzeit Fremdwörter. Das wirft die Frage auf, welche Absichten hinter diesen Aktionen stehen.
Ein Verfall des US-Dollars stimuliert den Export und macht amerikanische Waren im Ausland billiger. Somit steigt der Absatz im Ausland für amerikanische Produkte. Beim Import werden ausländische Waren durch die Zölle und die Währungsaufwertung (z. B. Euro) teurer und der Amerikaner greift eher zu inländischen Produkten. Das führt zu einer Verringerung des Handelsdefizits.
Auf der anderen Seite stehen der Vertrauensverlust, steigende Inflation und höhere Zinsen sowie der Ruf auf dem Spiel, die Weltreservewährung zu sein. Ein Blick in die Geschichte zeigt einen vergleichbaren Fall. Das Plaza-Abkommen von 1985. Damals beschlossen die G5-Staaten den US-Dollar gezielt zu schwächen, um das Handelsbilanzdefizit der USA zu reduzieren. Ziel war es, den US-Dollar gegenüber dem Yen und der Deutschen Mark abzuwerten, um Handelsungleichgewichte zu korrigieren und die Weltwirtschaft zu stabilisieren.
Sollte der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung verlieren, hätte dies schwerwiegende Folgen. Die Nachfrage nach US-Dollar-Staatsanleihen würde sinken und einen Anstieg der Zinsen zur Folge haben. Die bisher einfache Kreditaufnahme würde sich maßgeblich erschweren. Angesichts der aktuellen Herausforderungen bleibt der US-Dollar zwar unter Druck, doch die wirtschaftliche Stärke der USA bieten weiterhin solide Perspektiven – insbesondere für Investoren, die auf amerikanische Aktien setzen.
Dietmar Holzer, dietmar.holzer@vvb.at, Private Banking der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.